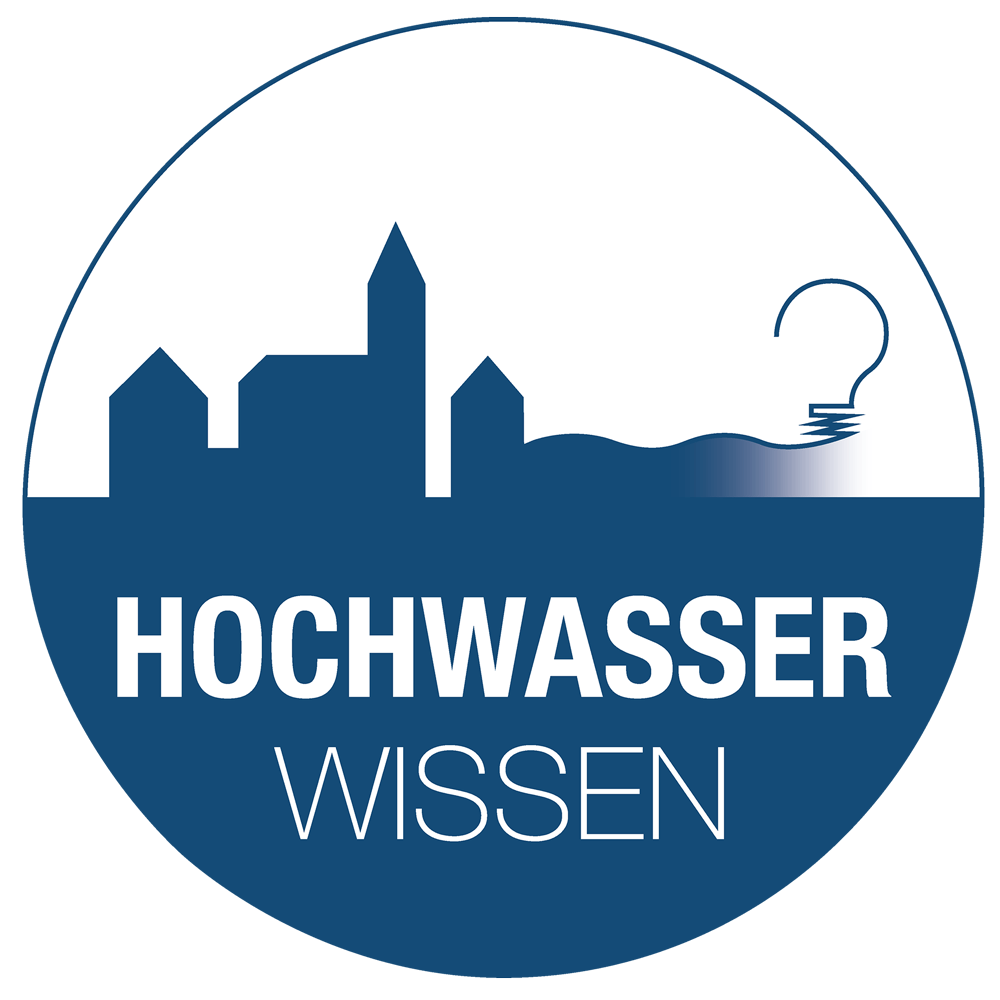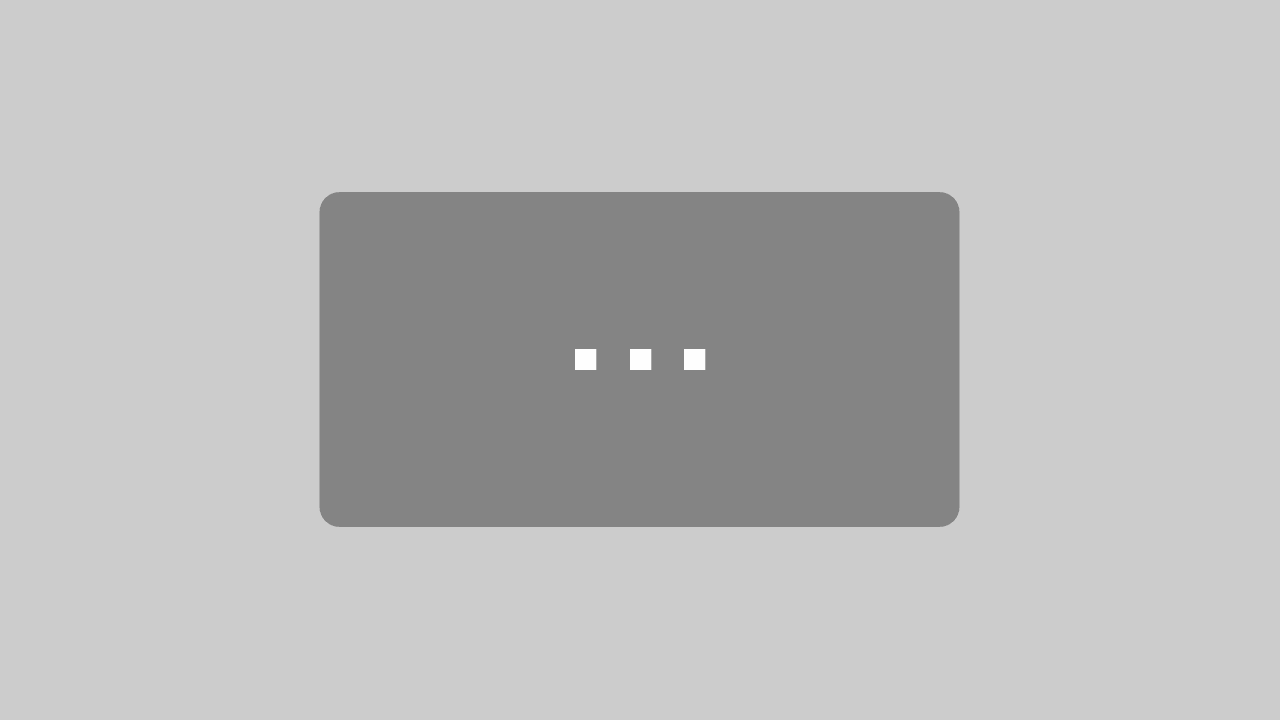Abflussuntersuchung und Gefahrenzonenplan (Bayern)
Um die Bevölkerung vor Hochwasser schützen zu können, ist es natürlich wesentlich zu wissen, wo besonders gefährdete Bereiche sind. Diese Bereiche sind in den sogenannten Gefahrenzonenplänen dargestellt, welche durch Experten und Expertinnen erstellt werden und nach einer Prüfung der Allgemeinheit zugänglich sind. Die Gefahrenzonenpläne dienen neben anderen Daten in der Raumordnung, bei Baumaßnahmen, bei Planungen von Hochwasserschutzmaßnahmen und Katastropheneinsatzplänen und vielem mehr als Basis für Entscheidungen. Außerdem dienen sie der Information und Bewusstseinsbildung für betroffene Bürgerinnen und Bürger.
Hochwasserrisikomanagement hat den umsichtigen Umgang mit Hochwasser von der Quelle bis zur Mündung zum Ziel. So sollen Risiken für die menschliche Gesundheit, die Umwelt, das Kulturerbe und andere Schutzgüter nachhaltig reduziert werden. In einem ersten Schritt werden Gebiete mit erhöhtem Hochwasserriskiko ermittelt („Fortschreibung der Risikokulisse“). Für diese Gebiete werden Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten erstellt. Die Karten sind die Grundlage für die Hochwasserrisikomanagement-Pläne, die Maßnahmen zum Hochwasserschutz und zur -vorsorge enthalten. Außerdem werden die Karten von Kommunen als Entscheidungshilfe für kommunale Planungen (z.B. bei der Bauleitplanung) genutzt und dienen Einzelpersonen dazu, persönliche Vorsorgemaßnahmen zu treffen.
Zudem bieten die Wasserwirtschaftsämter den Kommunen, in denen Gefährdungen für Schutzgüter bestehen, Beratungsgespräche an. Beim sogenannten „Risikodialog“ werden mit unterschiedlichen Akteur*innen, wie z.B. kommunalen Vertreter*innen, der örtlichen Feuerwehr und Personen oder Ver- und Entsorgungsbetrieben, eine Risikobewertung durchgeführt sowie Maßnahmen festgelegt. Diese gehen wiederum in die Hochwasserrisikopläne ein. Alle 6 Jahre werden diese Risikodialoge in der Regel wiederholt.
Weiterführende Informationen zum Hochwasserrisikomanagement mit Karten und Publikationen zum Download sind auf der Internetseite des Landesamt für Umwelt zu finden: https://www.lfu.bayern.de/wasser/hw_risikomanagement_umsetzung/index.htm
Bei Hochwassergefahrenkarten gibt es zwei verschiedene Kartentypen: „Eintrittswahrscheinlichkeit“ und „Wassertiefe“. Der Kartentyp „Eintrittswahrscheinlichkeit“ stellt Überflutungsflächen für die unterschiedlichen Hochwasserszenarien in einer Karte dar.
Beim Kartentyp „Wassertiefe“ werden die zu erwarteten Wassertiefen in fünf Abstufungen angezeigt. Für jedes Hochwasserszenario (HQhäufig, HQ100, HQextrem) gibt es eine Karte. Die Wassertiefen werden in Blautönen dargestellt. Hierbei gilt, umso dunkler die Farbe ist, umso größer ist die Wassertiefe.
Außerdem zeigen die Gefahrenkarten Wassertiefen in den sogenannten geschützten Gebiete. Das sind Bereiche, die durch Schutzmaßnahmen (Deiche, Mauern, mobile Elemente etc.) vor Überflutungen beim HQ100 geschützt sind. Da auch hier ein Risiko verbleibt – etwa wenn die geschützten Gebiete bei Deichbrüchen oder durch ansteigendes Grundwasser überflutet werden – werden die Wassertiefen in Gelb-Orange-Tönen angezeigt. Die Darstellung ist nicht für alle Risikogewässer in Bayern verfügbar.

Hochwasserrisikokarten hingegen stellen die Betroffenheit bei Hochwasser dar, indem die Hochwassergefahrenflächen mit Landnutzungsdaten verschnitten werden. Vor allem die vier Schutzgüter menschliche Gesundheit, Umwelt, Kulturerbe und wirtschaftliche Tätigkeit/erhebliche Sachwerte sind dabei zu berücksichtigen. Dadurch kann man für die verschiedenen Nutzungen auf die zu erwartenden Schäden schließen, die bei Eintreten einer Überflutung auftreten. Im Mittelpunkt stehen hier die Folgen für die menschliche Gesundheit und die Umwelt.
Bei den Hochwasserrisikokarten gibt es für jedes Szenario (HQhäufig, HQ100, HQextrem) eine Karte. Neben den Flächennutzungen sind auch Industrieanlagen, von denen eine Gefahr für die Umwelt ausgehen könnte, sowie Wasserschutz-, Naturschutzgebiete und Kulturgüter dargestellt.
Ergänzend zu den Hochwasserrisikokarten gibt es noch Beiblätter, die für Städte und Gemeinden erstellt werden. In den Beiblättern sind statistische Größen und Hintergrundinformationen zu den Schutzgütern (z.B. Anzahl der betroffenen Einwohner*innen) enthalten. Vor allem für die Planung von Maßnahmen können solche Informationen von großer Bedeutung sein.
Abbildung 1: Gewässer mit besonderem Hochwasserrisiko in Bayern, Stand 2018 (Quelle: Landesamt für Umwelt)

Die Hochwassergefahrenkarten werden vom Bayerischen Landesamt für Umwelt in Zusammenarbeit mit den Wasserwirtschaftsämtern und Ingenieurbüros erstellt. Basis sind Computersimulationen, die das Ausmaß verschiedener Szenarien berechnen. Die einzelnen Schritte und Grundlagendaten werden im Folgenden näher erläutert.
Geländemodell
Die gesamte Landesfläche von Bayern ist im sogenannten „Digitalen Geländemodell“ erfasst, welches die Grundlage für alle weiteren Arbeitsschritte bildet. Das digitale Geländemodell bildet die Geländeoberfläche von Bayern sehr detailliert ab und wird mittels flug-gestützter Laservermessungen erstellt. Da hier auch Gebäude, Waldstrukturen etc. miterfasst werden, wird das Geländemodell nachbearbeitet, um nur die rein topographischen Strukturen (Oberflächenstruktur, Gewässerläufe etc.) zu erhalten. Mit einer Vermessungsdichte von mindestens 4 Messpunkten pro m2 (seit 2012, davor mindestens 1 Messpunkt pro m²) ist das Geländemodell sehr exakt.
Abflussganglinie
Um durch das digitale Geländemodell eine passende Abflusswelle durchschicken zu können, benötigt man die Hochwasserabflüsse bei einem häufigen, 100-jährlichen und extremen Hochwasserereignis. Der Abfluss gibt die Menge an Wasser an, die in einer gewissen Zeiteinheit durch einen Flussquerschnitt abfließt. Eine Abflussganglinie stellt den Verlauf des Abflusses über eine gewisse Zeitperiode dar.
Niederschlags-Abflussmodell (NA-Modell)
Unter Berücksichtigung der Geländeform, der Landnutzung und der Bodeneigenschaften sowie von Verlustbeiwerten wird ein Computermodell erstellt, das aus einer definierten Niederschlagsmenge und Niederschlagsdauer die zugehörige Abflussganglinie berechnet. Je nach Größe und Beschaffenheit des Einzugsgebietes können unterschiedliche Eingangsdaten verwendet werden um möglichst realitätsnahe Ergebnisse zu erzielen. Typischerweise werden bei NA-Modellierungen die Abflussganglinien für die Hochwasserereignisse HQhäufig, HQ100 und HQextrem ermittelt.
Für die Kalibrierung des Modells werden zudem beobachtete historische Hochwasserereignisse herangezogen. Diese Informationen gewinnt man beispielsweise aus alten Aufzeichnungen, von Hochwassermarken oder durch die Berichte von Ortsansäßigen.
Hydrodynamisches Modell
Das hydrodynamische Modell ist nun jenes Instrument, mit dem aus dem Geländemodell und den Abflussganglinien Überflutungsflächen berechnet werden. Das Geländemodell wird dazu noch mit Rauigkeiten ergänzt, welche die unterschiedlichen Strukturen der Geländeoberfläche widerspiegeln. Dies ist wichtig, da die Rauigkeiten maßgblich den Fließwiderstand und somit die Fließgeschwindigkeit beeinflussen. Auf einer sehr glatten Asphaltoberfläche fließt das Wasser beispielsweise viel schneller ab als auf einem Getreidefeld im Sommer, wo der Oberflächenabfluss durch die Pflanzen stark gebremst wird. Andere lokale Begebenheiten wie der Transport von Geröll während eines Hochwasserereignisses oder die Änderung der Vegetation mit dem Jahresverlauf müssen nach Bedarf auch miteinbezogen werden.
Im Umweltatlas Bayern (https://www.umweltatlas.bayern.de/startseite/) können die Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten unter dem Themenbereich „Naturgefahren“ eingesehen werden. Für die richtige Handhabung der Website verfügt diese über ein Benutzerhinweis-Handbuch in der die wichtigsten Schritte erklärt werden. Ebenso besteht dort auch die Möglichkeit, gewisse Bereiche als PDF-Karten zu öffnen und auszudrucken. Einsehen kann man diese Informationen auch unter www.iug.bayern.de
Eine weitere Möglichkeit besteht über das LfU-Internetportal im Themenbereich „Umsetzung des Hochwasserrisikomanagements in Bayern“. Im Themenkomplex „Hochwassergefahrenkarten und Hochwasserrisikokarten“ können Karten nach Gemeindegebiet heruntergeladen werden. Außerdem sind noch weiterführende Informationen und Publikationen zum Thema zu finden (z.B. die Lesehilfe – Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten)
https://www.lfu.bayern.de/wasser/hw_risikomanagement_umsetzung/index.htm
Unter „Hochwasserinfo Bayern“ (https://www.hochwasserinfo.bayern.de/) können Informationen zur Aktuellen Lage, zur Eigenvorsorge oder zu weiterführenden Themen abgerufen werden.