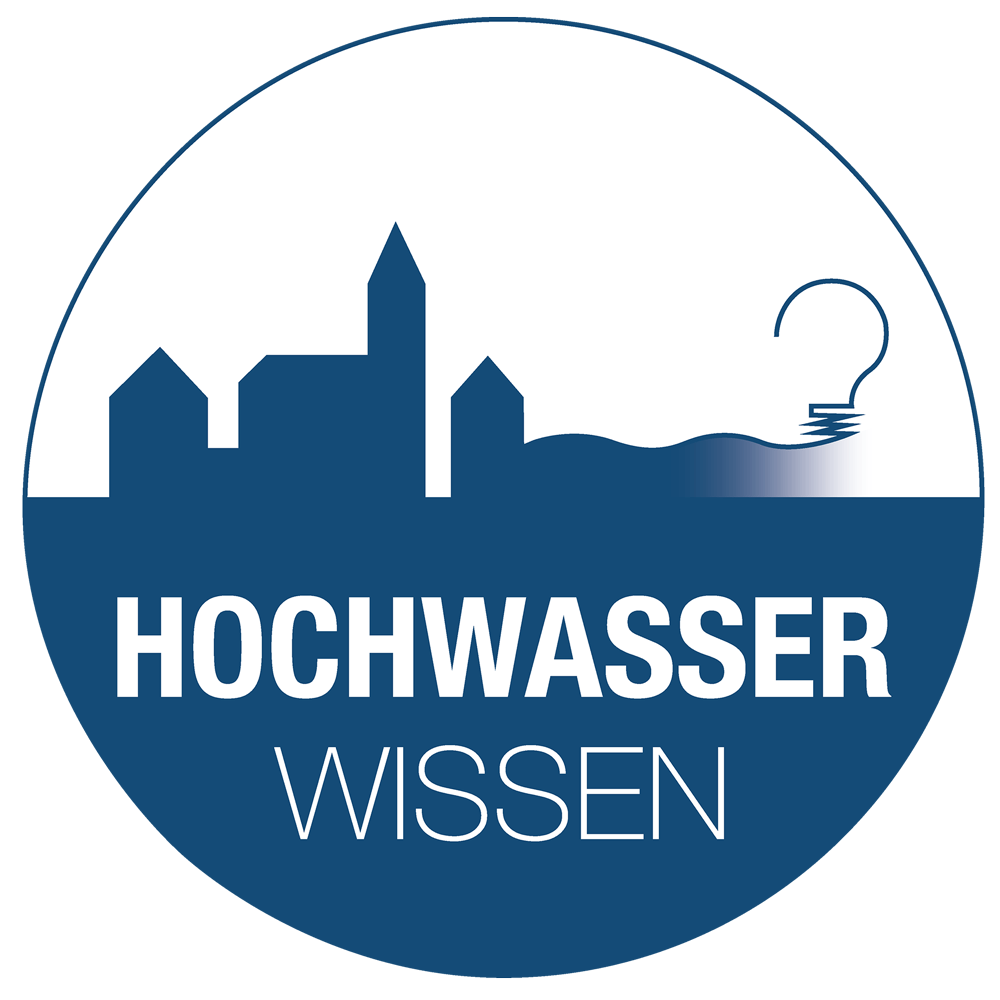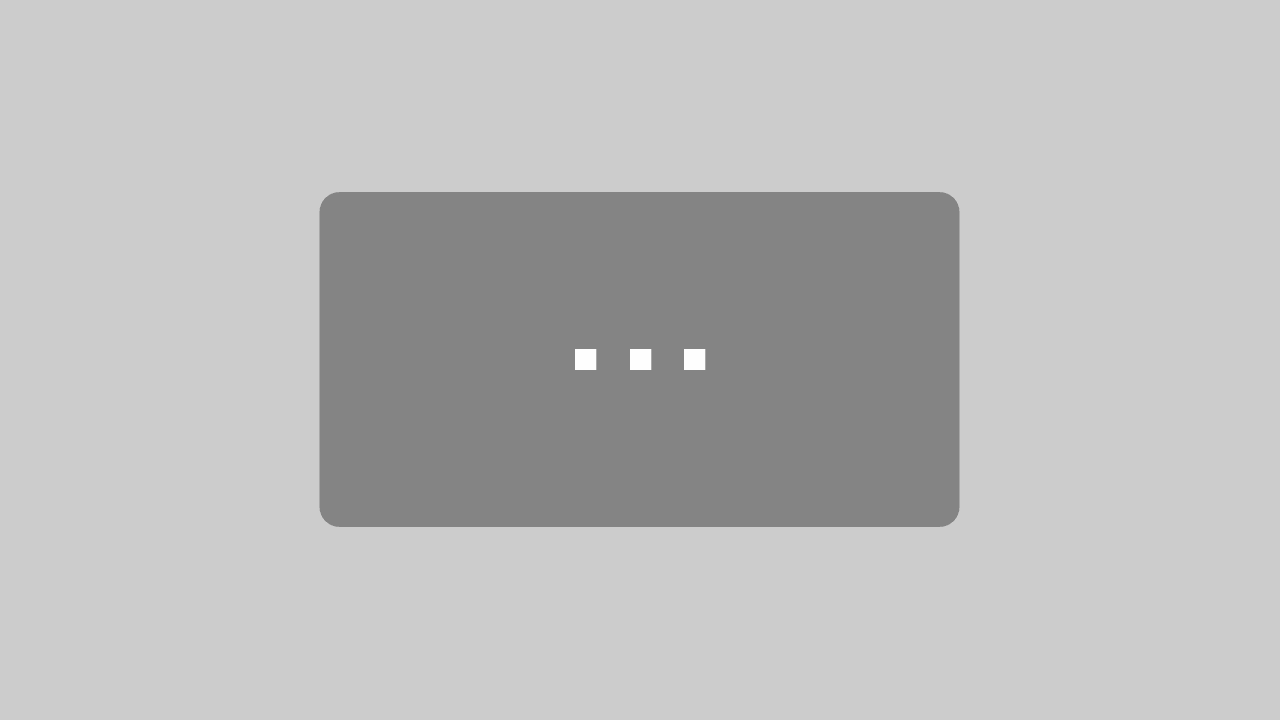Hochwasserschutz-Maßnahmen

Hochwasserschutz-maßnahmen
Im Jahr 2007 ist die EU- „Richtlinie über die Bewertung und das Management von Hochwasserrisiken“, kurz auch „Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie“ genannt, in Kraft getreten. Ihr Ziel ist es einen EU-weiten einheitlichen Rahmen für die Bewertung und das Management von Hochwasserrisiken zu schaffen. Das Hochwasserrisikomanagement soll dabei vor Grenzen nicht Halt machen, sondern eine einzugsgebietsbezogene Betrachtung ermöglichen.
In den Plänen für das Hochwasserrisikomanagement werden Maßnahmen festgelegt, die zum Erreichen der zuvor festgelegten Ziele notwendig sind. Diese Maßnahmen basieren auf einem umfassenden Hochwasserrisikomanagement, das nicht nur technische Schutzmaßnahmen, sondern alle Komponenten im Risikokreislauf miteinbezieht (siehe Abbildung 1)
Dazu gehören neben baulichen Maßnahmen, Nicht-bauliche Maßnahmen in der Planung (Raumordnung, Gefahrenzonenplanung), Nicht-bauliche Maßnahmen in der Bewirtschaftung (z.B. Forstwirtschaft), sowie
Information und Bewusstseinsbildung. Letztere sind auch für die Einsatzplanerstellung relevant, da betroffene Personen dadurch für das Thema sensibilisiert und im Idealfall über Möglichkeiten zur Eigenvorsorge informiert werden. Wenn diese Aufklärung im Vorfeld stattfindet, können Einsatzkräfte im Hochwasserfall durch Hilfe zur Selbsthilfe massiv entlastet werden.
Bauliche Hochwasserschutz- Maßnahmen
Die beschriebenen baulichen Hochwasserschutzmaßnahmen beinhalten technische Anlagen, die dazu dienen, Wasser von Bereichen mit Schadenspotential fernzuhalten. Dabei wird oft eine Kombination aus mehreren Maßnahmen und Anlagenteilen eingesetzt.
Die einzelnen Anlagen bestehen in der Regel aus verschiedenen Anlagenteilen, die zur Erfüllung der Schutzfunktion erforderlich sind. Dabei ist wiederum eine Kombination aus verschiedenen Anlagenteilen möglich bzw. sind nicht immer alle gelisteten Teile in einer Anlage vorhanden. Die Anlagenteile der im jeweiligen Wirkungsbereich liegenden Hochwasserschutzmaßnahmen sind daher im Vorfeld zu erheben, um im Hochwasserfall auf mögliche Versagensmechanismen vorbereitet zu sein.
Die gleichen Anlagenteile können auch in unterschiedlichen Maßnahmentypen vorhanden sein (Dämme können beispielsweise bei Rückhaltebecken oder bei linearen Hochwasserschutzdämmen/-deichen vorkommen). Die unterschiedlichen Anlagenteile, potentielle Versagensmechanismen und Verteidigungsstrategien werden in Kapitel 0 behandelt.
- Rückhaltemaßnahmen: Maßnahmen zum Hochwasserrückhalt dienen dazu, die Abflussmenge bei Hochwasser zu regulieren. Dazu wird Wasser auf einer geeigneten Fläche aufgestaut. Je nach Lage zum Fluss kann zwischen Hochwasserrückhaltebecken im Hauptschluss und im Nebenschluss (auch „Flutpolder“ genannt) unterschieden werden. Rückhaltebecken werden auch „Retentionsbecken“ genannt. Ziel ist es, durch eine Drosselung des Abflusses und den Rückhalt von Wasser nur soviel nach unten weiterzugeben, wie schadfrei im Gewässer abgeleitet werden kann.
- Lineare Maßnahmen: z.B.: Flutmulden, Entlastungsgerinne, Vergrößerung Abflussquerschnitt, Hochwasserschutzdamm/-deich, Hochwasserschutzmauer/-wand, mobilder Hochwasserschutz, Ufersicherung, Verrohrung/Eindeckung
- Punktuelle Maßnahmen: z.B.: Wildholzrückhalt, Murbrecher, Brücke, Furt
Anlagenteile und Versagensmechanismen
Folgende Anlagenteile können unterschieden werden:
- A.1 Absperrbauwerk
- A.1.1 Mauer
- A.1.2 Damm
- A.2 Auslassbauwerk
- A.3 Drossel / Steuerung
- A.3.1 Ungesteuerte Anlagen
- A.3.2 Gesteuerte Anlagen
- A.4 Einlaufbauwerk
- A.5 Hochwasserentlastung / Überströmstrecke
- A.6 Mess-, Steuer und Regelungstechnik
- A.7 Pumpwerk / Schöpfwerk
- A.8 Rechen
- A.9 Tosbecken
- A.10 Uferverbauung
- A.11 Untergrundabdichtung
- A.12 Verrohrung / Durchlass / Brücke
Jede Maßnahme kann aus unterschiedlichen Anlagenteile bzw. einer Kombination daraus bestehen. Grundsätzlich sind für die Maßnahmen folgende Anlagenteile möglich. (siehe Abbildung)